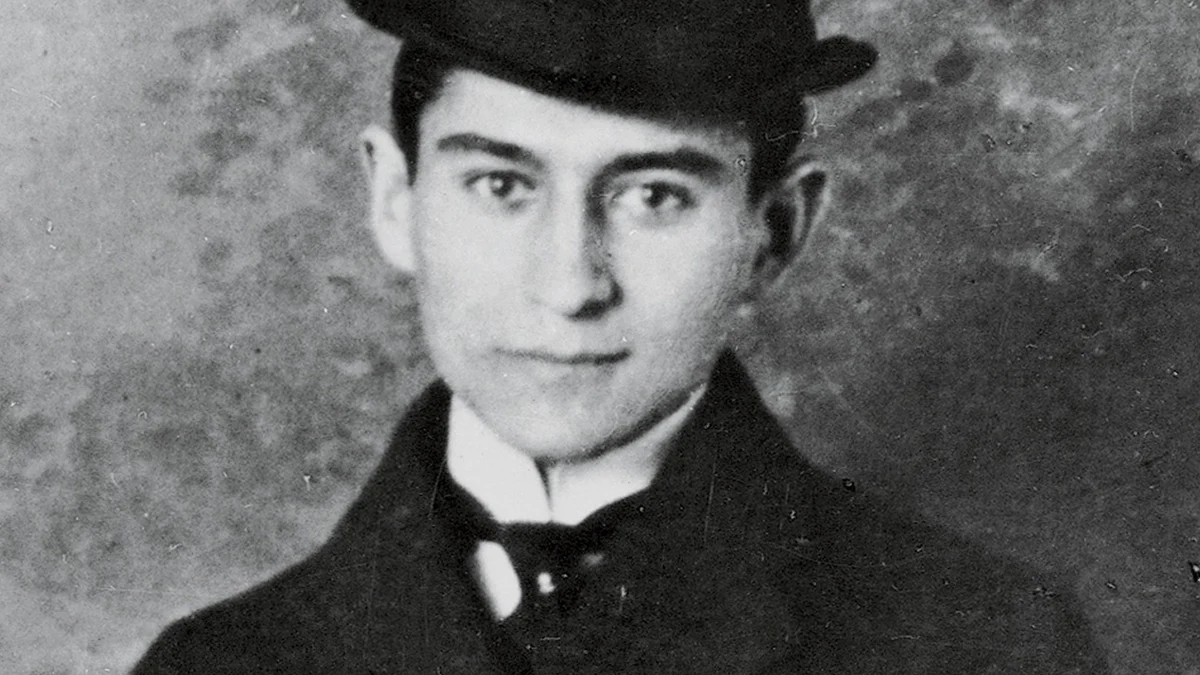Der Europarat kämpft 75 Jahre nach seiner Gründung gegen den Kollaps. Für Außenministerin Baerbock ist klar: Die Organisation wird angegriffen, auch von Autokraten wie Wladimir Putin. Doch das ist nicht das einzige Problem. Aus Straßburg berichtet Patrick Diekmann. Manchmal ist Politik wie das Zusammenspiel in einer großen Familie. Auch in internationalen Organisationen gibt es Streit, vor allem, wenn alle an einem Ort zusammenkommen. Dann knallt es schon mal. Aber am Ende finden sich meist Lösungen und es obsiegt die Gewissheit, dass man trotz Meinungsverschiedenheiten doch irgendwie zusammengehört. Außer, es gibt unüberbrückbare Differenzen, einen großen Knall. Dann kann es passieren, dass ein Mitglied dem Rest der Familie den Rücken kehrt. Der Europarat hat all das in den vergangenen 75 Jahren erlebt. Zuletzt hatte 2022 Russland die Organisation verlassen, nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine . Seitdem versucht der Kreml, die Institutionen zu sprengen. Teilweise geht dieser Plan auf. Doch beim Festakt zum 75. Jubiläum des Europarates in Straßburg am Donnerstag wird klar: Russland ist nicht das einzige Problem für den Europarat. Der momentane Sturm ist viel größer. Einige Mitglieder drohen mit Austritt, andere möchten Urteile des zu der Organisation gehörenden Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) nicht umsetzen. Allgemein kämpft die Institution gegen die Bedeutungslosigkeit, auch weil Nationalismus und Protektionismus auf dem europäischen Kontinent an Bedeutung gewinnen. Für die internationale Zusammenarbeit in Europa ist diese Entwicklung fatal. In Straßburg versucht Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), den Europarat als Institution zu verteidigen. Aber die Gräben sind tief und die Probleme für die Organisation werden größer. Damit nicht alles auseinanderbricht, braucht es einen wahren Kraftakt. Europarat hat ein PR-Problem Viele Menschen in Europa nehmen den Europarat kaum wahr, wissen nicht einmal, was genau er macht. Seit die Europäische Union immer wichtiger wird, schwindet seine Bedeutung. Zu leicht lässt er sich verwechseln mit dem Europäischen Rat, der aus den 27 Staats- und Regierungschefs der EU besteht, zumal sowohl EU als auch Europarat die gleiche Fahne und die gleiche Hymne nutzen. Als erste große europäische Nachkriegsorganisation 1949 gegründet, setzt sich der Europarat für den Schutz von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaat ein. Zu den 46 Mitgliedern gehören alle Länder der EU, aber auch Großbritannien oder die Türkei . Er ist so zuständig für 680 Millionen Europäerinnen und Europäer – von Grönland bis Aserbaidschan. Das schärfste Schwert des Europarats bleibt dabei der Gerichtshof für Menschenrechte. Er wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), die alle Mitglieder des Europarats unterzeichnet haben. Sie sichert wichtige Rechte zu, etwa das Recht auf Leben, das Verbot der Folter oder die Meinungsfreiheit. Wer sich in seinen Rechten verletzt fühlt, kann vor dem EGMR klagen – die Richtersprüche sind bindend. Viele größere Errungenschaften zur Verbesserung der Menschenrechtslage in Europa sind dem Europarat zu verdanken. Auch heute noch versucht die Organisation etwa Gleichberechtigung oder den Schutz von Minderheiten in allen Mitgliederstaaten zu verbessern. Die Institution hat somit das gesellschaftliche Zusammenleben in Europa mitgeprägt, auch wenn viele Menschen auf dem Kontinent nichts davon wissen. Denn der Europarat hat definitiv ein PR-Problem – und das will auch die Bundesregierung ändern. Für Baerbock eine Herzensangelegenheit Schon vor ihrer Reise nach Straßburg rief Baerbock im Bundestag dazu auf, die unter Druck geratenen Werte des Europarats zu verteidigen. „Unsere europäische Art zu leben, die Werte unseres Europarats, sie werden herausgefordert wie nie zuvor seit dem Ende des Kalten Krieges“, erklärte die Grünen-Politikerin. Auch beim Festakt in Straßburg erinnert Baerbock an die Gefahren, die der Organisation drohen. Die Werte des Europarats würden von „außen durch Autokraten wie Wladimir Putin , der den Eroberungskrieg zurück nach Europa gebracht hat, aber auch von innen mit Hass und einer Rückkehr des Völkischen“ bedroht, erklärte sie im Bundestag. Journalisten würden eingesperrt, Gerichte sollten manipuliert werden, gegen sogenannte Fremde werde gehetzt. Immer wieder sehe man, „wie Hass in Gewalt umschlägt und wie sie jeden treffen kann“. Baerbock spielt darauf an, dass etliche Mitglieder dem autoritären Führungsstil des Kreml-Herrschers durchaus etwas abgewinnen können. Die Türkei, Ungarn , die Slowakei , Serbien oder Aserbaidschan. Aber es ist eben nicht nur der Ukraine-Krieg, der den Europarat spaltet. Problem: Urteile könnten nicht durchgesetzt werden Unter den 46 Mitgliedsstaaten sind aktuell einige Wackelkandidaten, bei denen unklar ist, wie unverbrüchlich sie tatsächlich zum Europarat stehen. Serbien droht mit dem Austritt, falls das Kosovo wie geplant Mitglied wird. Aserbaidschans Delegation wurde Anfang des Jahres für ein Jahr aus der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ausgeschlossen, weil das Land Wahlbeobachtern den Zutritt verweigert hatte. Die Türkei setzt seit Jahren wichtige Urteile des zum Europarat gehörenden Gerichtshofs für Menschenrechte nicht um und sperrt etwa den Kulturförderer Osman Kavala weiter ein. Aber nicht nur autoritär regierte Länder stellen die Werte des Europarats infrage. Auch Großbritannien hadert mit Urteilen des Gerichtshofs, etwa weil die Richter 2022 die Regierung in London in letzter Minute gehindert hatten, Asylsuchende per Flieger nach Ruanda zu schicken. Premier Rishi Sunak kündigte bei der Verabschiedung eines Asylpakts mit Ruanda an, einstweilige Verfügungen des EGMR künftig zu ignorieren. In Straßburg geht am Donnerstag die Sorge um, dass diese Beispiele Schule machen. Im Prinzip sind Urteile des EGMR zwar bindend, aber der Europarat hat keine Durchsetzungsmöglichkeiten. Oft wird er deswegen als Papiertiger verspottet. Der Leiter der Deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Frank Schwabe (SPD), sieht das anders: „Die EU hat ökonomische Möglichkeiten, ja klar, die hat der Europarat nicht. Aber der Europarat hat verbriefte Rechte.“ Dazu zählten etwa das Recht, Wahlbeobachtungsmissionen zu schicken oder unangemeldet in Gefängnisse zu gehen. Es gilt auch als eher unwahrscheinlich, dass Länder wie die Türkei oder Serbien aus der Organisation austreten. Denn für sie ist der Europarat ein Tor in die europäische Politik, eine Möglichkeit der Einflussnahme. Allerdings kann so auch der Kreml – etwa über Serbien, das abhängig von Russland ist – weiter Einfluss auf die Institution nehmen. Zeit der Selbstvergewisserung Zudem laufen Urteile des EGMR oft in eine Sackgasse. Als bräuchte es dafür ein aktuelles Beispiel, platzt am Donnerstag eine Nachricht in die Jubiläumsfeier des Europarates: Ein türkisches Gericht hat den früheren Vorsitzenden der pro-kurdischen HDP-Partei, Selahattin Demirtaş, zu insgesamt mehr als 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Eklat in Straßburg, immerhin hatte der Europarat die Freilassung von Demirtaş gefordert, er sieht ihn als politischen Gefangenen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Aber das Europarat-Mitglied Türkei ignoriert das Urteil seit Jahren. Deswegen bleibt auch Baerbock bei der Feier in Straßburg nur ein Appell an die Mitgliedsstaaten, sich an die Urteile des Gerichtshofs zu halten. „Wenn wir wollen, dass dieser Rat als wirksames Frühwarnsystem dient, müssen wir zuhören, wenn er Alarm schlägt.“ Autokraten von außen und Demagogen von innen hätten eines gemeinsam: „Sie betrachten unsere demokratischen Werte als Schwäche. Aber sie liegen falsch.“ Das Versprechen, dass der Mensch ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Frieden und Freiheit habe, „ist stärker als Hass“. Dieses Versprechen sei „eine Verpflichtung, die niemals endet“. Doch die Existenz einer gemeinsamen Wertebasis ist in einigen Bereichen durchaus fraglich. Verträge und Abkommen sind schnell unterzeichnet, aber täten Staaten dies auch, wenn ihnen konkrete Sanktionen bei ihrer Missachtung drohten? Das ist unklar. Angesichts der Krisengewitter müssen die Mitglieder erst noch beweisen, ob sie in der Lage sind, politisch gemeinsame Nenner zu finden. Dass das bei 46 Mitgliedern schwierig werden wird, demonstrieren deutlich kleinere Familien – etwa die Nato oder die EU – immer wieder.
75 Jahre Europarat – Außenministerin Baerbock sieht Werte in Gefahr